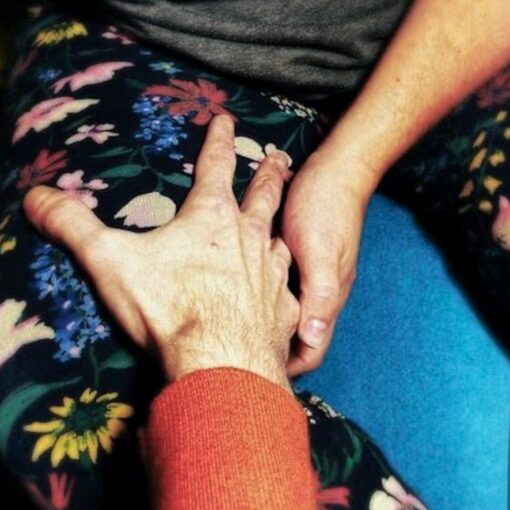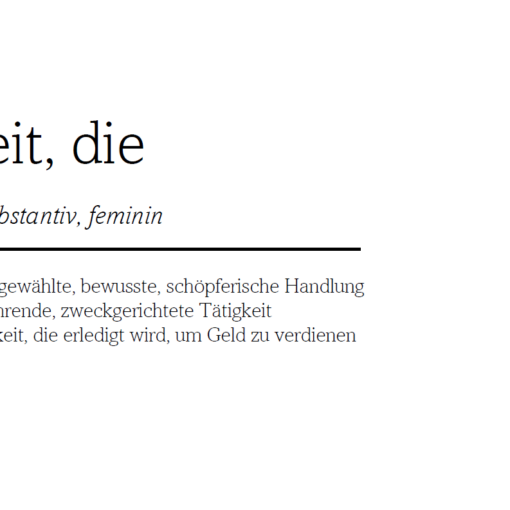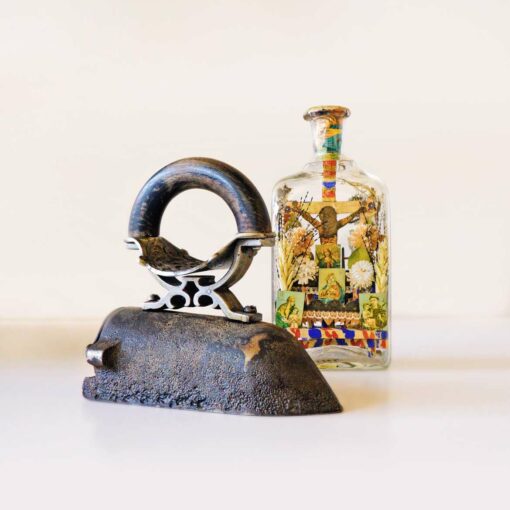Der Fußball hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem globalisierten Produkt entwickelt. Für Alfred Tatar hat das viele Nachteile gebracht – auch im Bereich Leistungsdruck.
Im Interview spricht Alfred Tatar über die Thematik Druck im Profifußball. Der 59-Jährige hat in seiner Laufbahn als aktiver Spieler 68 Spiele in der österreichischen Bundesliga absolviert. Später war er als Trainer u.a. bei der SV Ried, dem SV Mattersburg und in Russland tätig. Außerdem hat er ein Biologie-Studium absolviert. Seit 2015 ist Tatar beim Pay-TV-Sender Sky Fußball-Experte und ist für seine kultigen Sprüche bekannt.
von Mathias Blaas

Wenn Sie sich an ihre aktive Zeit als Fußballer zurückerinnern, wie sind Sie mit dem Thema Leistungsdruck umgegangen?
Ich glaube, dass man früher mit heute nicht vergleichen kann. Der Unterschied besteht darin, dass es heute zwei verschiedene Arten von Leistungsdruck gibt.
Möchten Sie das genauer ausführen?
Natürlich. Der eine Leistungsdruck, den es bereits vor der Globalisierung des Fußballs vor etwa 30 Jahren gab, ist der intrinsische Druck. Das ist der Druck, den man sich selbst gemacht hat. Man wollte besser werden, man wollte gewinnen. Man hat versucht, sich im Training zu verbessern und gute Leistungen im Spiel zu bringen. Der heutige Leistungsdruck besteht einerseits aus dem genannten intrinsischen Druck, aber es gibt darüber hinaus einen anderen Leistungsdruck: Den externen Druck. Das ist der Druck über die Medien und im Speziellen, wie der Fußball mittlerweile aufgeladen wird mit Dingen, die mit dem Sport selbst nichts mehr zu tun haben. Politische Themen zum Beispiel. Durch die sozialen Medien werden Fußballer zusätzlich beobachtet. Da werden permanent werden Kommentare abgegeben. Man muss vor der Community bestehen. Das gab es zu meiner aktiven Zeit noch nicht.
Also würden Sie sagen, dass der Druck heute deutlich größer ist als in den 1980er-Jahren?
Der heutige Druck ist viel höher. Die Spieler sind von allen Seiten unter Beobachtung. Sponsoren, eigene Werbeverträge und soziale Medien sorgen für immensen Druck. Der Fußball ist heutzutage aufgeblasen ohne Ende. Ich möchte es nochmal betonen: Wir haben heute einen Druck, der über den intrinsischen Druck hinausgeht. Der Fußball hat sich in diese Richtung verschlechtert.
Wie sieht es im Amateurbereich aus?
Ich glaube, dass im Nachwuchs- und Amateurfußball noch der intrinsische Druck zählt. Da setzen sich die Kicker eigene Ziele. Durch Training und gute Leistung unterwerfen sich diese Fußballer einem Leistungszug. Da fällt der externe Druck vom Profifußball weg.
Wie würden Sie den Druck zwischen einer Person mit einem „normalen“ Job im Gegensatz zu einem Profifußballer unterscheiden?
Es ist so, dass wir in einem kapitalistischen System leben. Der Umstand, dass den Fußballern bei der Arbeit 50.000 oder 70.000 Leute zuschauen und im Fernsehen noch ein paar Millionen, ist das nicht vergleichbar mit der Arbeit, die ein herkömmlicher Mensch hat. Der normale Mensch hat maximal einen Chef, der ihn beobachtet. Fußballer werden heute vor einem riesigen Publikum zur Schau gestellt. Das ist ein Hauptgrund, warum Fußballer so unverschämt bzw. unmoralisch viel verdienen. Ein normaler Mensch bringt genauso Leistung, aber halt innerhalb des Rahmens, wo er seine Arbeitsstätte hat. Der Leistungsdruck der normalen Leute geht von Chefs oder Arbeitskollegen aus. Bei Fußballern geht das Thema Druck weit darüber hinaus. Daher ist auch die Bezahlung eine völlig andere. Man könnte sagen, es ist wie im Showbusiness und im Showbusiness verdient man mehr.
Ein Beispiel aus Ihrer Karriere. Wann haben Sie viel Druck verspürt?
Als Spieler ist es sich wie gesagt nicht mehr ausgegangen, diesen argen Leistungsdruck von außen zu bekommen. Meine Karriere war Mitte bzw. Ende der 80er Jahre zu Ende. Damals hatte ich reinen Druck, der intern vom Verein, Trainer und von mir selbst ausging.

Wie war es später in Ihrer Trainerlaufbahn?
Gespürt habe ich den öffentlichen Druck tatsächlich erstmals als ich in Russland Trainer war. Der Verein hatte damals ein Budget von 70 oder 80 Millionen Euro. Da sind Geldgeber dahinter, die Erfolg sehen wollen. Da hast du als Trainer einen Druck, der dem Druck der Spieler analog ähnelt. Die Trainer stehen in derselben Auslage wie die Spieler, vielleicht sogar noch mehr. Wie oft in den Fernsehsendungen zu sehen ist, wird die Kamera oft auf die Trainer gerichtet. Egal was sie machen, sie werden auch 90 Minuten lang gefilmt. Es wird festgehalten, wie sie coachen, wie sie Anweisungen geben, wie sie jubeln, wie sie verzweifeln. Auch die Trainer sind mittlerweile in dieser Hinsicht exponiert. Dementsprechend erleiden die Trainer einen ähnlichen Druck wie die Spieler.
Hat es zu Ihrer Zeit in Russland eine spezielle Betreuung für Spieler, Trainer oder Mitarbeiter gegeben, was das Thema Druck betrifft?
Nein. Das gibt es meines Wissens auch heute nicht. Die Sportpsychologen, die solche Dinge leiten, haben im modernen Fußball ein geringes Standing. Das Management des Drucks wird einzig und allein vom Cheftrainer und seinem Trainerteam abgewickelt. Dass es eigene Personen in einem Verein gibt, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, kenne ich aus dem modernen Profifußball nicht.
Wäre es Ihrer Meinung nach aber notwendig, im Jahr 2022 in jedem professionellen Fußballverein eine spezielle Betreuung für Spieler anzubieten?
Die große Frage ist, inwieweit Trainerteams Einmischungen in diese Bereiche zulassen. Als Trainer bist du eine Persönlichkeit, die auf die Spieler einwirkt. Die Trainer nehmen eine Art Psychologenrolle ein. In den Vereinen hat es bisher noch nicht Einzug gehalten, dass man Spezialisten in diese Richtung einsetzt. Das ist eine sehr diffizile Angelegenheit.
Also würden Sie sagen, dass der Trainer das wichtigste Element ist, wenn es um den Umgang mit Leistungsdruck in einer Fußballmannschaft geht?
Genauso ist es. Aus meiner Sicht wäre es kein Nachteil, wenn Spezialisten in bestimmten Situationen mit Spielern auf individueller Ebene zusammenarbeiten. Damit meine ich zum Beispiel Spieler mit Versagensängsten. Aber im Mannschaftsgefüge bleiben die psychologischen Aufgaben dem Trainer überlassen.
Wie haben Sie die Situation um den ehemaligen ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger wahrgenommen, der im letzten Sommer im Alter von 29 Jahren überraschend seine Karriere beendet hat? Die offizielle Begründung für sein Karriereende waren Motivationsprobleme, dazu kamen noch Vorwürfe über rechtsradikale Verbindungen. Kann zumindest ersteres mit erhöhtem Leistungsdruck zusammenhängen?
Ich denke, dass ich als normaler Beobachter das schwer beurteilen kann. Ich denke aber, dass ein Spieler in seinen Entscheidungen völlig frei ist. Ich kann das vorzeitige Karriereende von Martin Hinteregger nicht kritisieren. Ob er in eine rechte Szene abgerutscht ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube einfach, dass er vom Hamsterrad Fußball genug hatte. Er hat wahrscheinlich genug Geld verdient und entschieden, dass das Leben nach dem Fußball auch wichtig ist. Ich kann ihn niemals verurteilen. Im Gegenteil: Ich gratuliere ihm zu einer großartigen Karriere und auch zu einer großartigen Entscheidung.
Es wurde bereits viel über das Thema Leistungsdruck im Fußball gesagt. Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Druck hat eine negative Konnotation und ist eine hemmende Einflussgröße. Zu meiner aktiven Fußballerzeit war Druck eher ein Leistungszug. Damals hat man sich selbst ‚ziehen‘ wollen, eine bessere Performance abzuliefern. Daher könnten die zwei Seiten des Drucks auch folgendermaßen definiert werden: Leistungsdruck kommt von der Öffentlichkeit und Leistungszug macht man sich selbst.