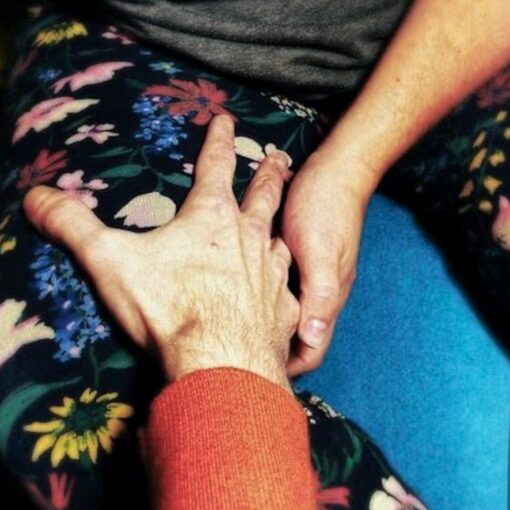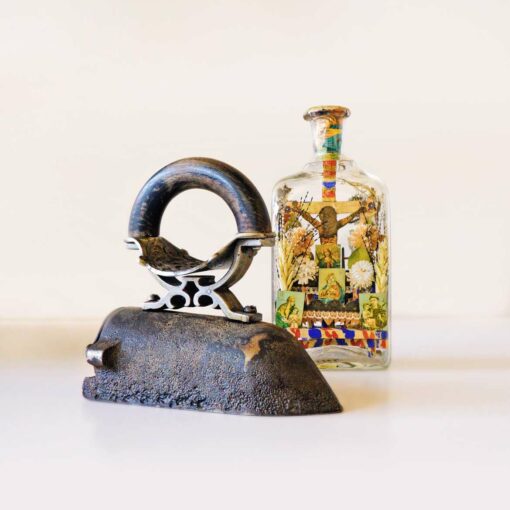So viele Stellenausschreibungen wie derzeit gab es in Österreich nicht mehr seit dem Ende des Krieges. Der Philosoph, emiritierte Professor der Universität Wien und Essayist Konrad Paul Liessmann spricht im Interview darüber, warum es sich lohnt über bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken und wie wir in Zukunft über Arbeit anders denken werden – und es auch schon tun.

Konrad Paul Liessmann © Zsolnay Verlag – Heribert Corn, corn@corn.at / OTS via picturedesk.com
Sie haben in einem Beitrag in dem Sammelband von Ulrich Beck Die Zukunft von Arbeit und Demokratie im Jahr 2000 zwei Thesen behandelt, die an sich widersprüchlich sind. Nämlich meinten Sie, dass die Arbeit immer weniger wird und wir immer mehr arbeiten. Was, meinen Sie, hat sich seither verändert?
Dass die Arbeit immer weniger wird, hat sich ja darauf bezogen, was ja nach wie vor ein aktuelles Problem ist, nämlich, dass der technische Fortschritt und die Digitalisierung tatsächlich auch zum Verlust von Arbeitsplätzen führt und geführt hat. Wir haben jetzt ganz aktuell eine Debatte über dieses Softwareprogramm „Chatgpt“ (anm. von der Webseite www.openai.com), wo nun sehr viele fürchten, wenn das eine Software ist, die von sich aus Texte generieren kann, dass eine ganze Reihe von, sagen wir mal Journalisten, ihre Arbeitsplätze verlieren. Man braucht jetzt keinen mehr, der Sportergebnisse zusammenfasst. Das heißt, die Sportberichterstattung wird sich radikal ändern, vermuten viele. Das heißt also, da haben wir nach wie vor dieses Gefühl, es gibt weniger Arbeit.
Auf der anderen Seite haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass offensichtlich nicht so viel automatisiert werden konnte, wie man sich vielleicht noch um die Jahrtausendwende erhofft hat. Dass vor allem in vielen produktionsnahen Branchen, wo Fachkräfte erfordert sind, wir tatsächlich momentan zu wenig Arbeitskräfte haben. Pflegeberufen oder im Schulwesen. Genauso im Dienstleistungssektor: Der Gag, sozusagen Kellnerinnen und Kellner durch Servierroboter zu ersetzen. Was man mancherorts schon probiert hat, hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, weil die Kunden offensichtlich auch nicht darauf ansprechen. Auch die Pflegeroboter, die es ja als technische Möglichkeit gibt, haben sich nicht durchgesetzt. Das heißt überall dort, wo es tatsächlich um soziale und kommunikative und betreuende Berufe geht, und dort, wo es um spezielle technische, orientierte Fachkräfte geht, haben wir einen Arbeitskräftemangel.
Freundschaft ist mittlerweile etwas, in das man investieren muss – man muss dafür arbeiten (…). Und da kann man natürlich kritisch die Frage stellen, ob das (..) sinnvoll ist (…)
Davon abgesehen war meine These „Wir arbeiten immer mehr“ einfach deshalb, weil wir immer mehr Tätigkeiten außerhalb der definierten Lohnarbeitsverhältnisse als Arbeit beschreiben: Beziehungsarbeit, häusliche Betreuungsarbeit, Kommunikationsarbeit. Freundschaft ist mittlerweile etwas, in das man investieren muss – man muss dafür arbeiten. Das heißt also, wir begreifen immer mehr Tätigkeiten als eine Form von Arbeit. Und da kann man natürlich kritisch die Frage stellen, ob das sehr gut oder sinnvoll ist oder ob es nicht auch eine Möglichkeit gäbe, für die ich damals plädiert habe, bestimmte menschlichen Tätigkeiten nicht als Arbeit zu definieren. Und mit diesem Paradigma müsste eigentlich auch organisiert werden, dass Lohnarbeit messbar ist: Es müsste eine Leistung sein, sodass bestimmte Tätigkeiten dann tatsächlich als freies Handeln, als soziale Praxis, zu beschreiben sind und nicht als Arbeit.
Das ist ein guter Punkt, um über bedingungsloses Grundeinkommen zu sprechen. Es wird oft als linkes Schreckgespenst und Gegenpol zum Neoliberalismus und damit „diesen Arbeitsfleiß“ gehandhabt wird. Aber die Debatte ist ja heute noch oder wieder aktuell, man denke nur an das gescheiterte Volksbegehren von 2019. Meinen Sie, lohnt sich denn eine ernsthafte Debatte um bedingungsloses Grundeinkommen heute?
Also ich glaube, diese Debatte lohnt sich sehr wohl. Es ist völlig klar, dass eine Idee, wie das bedingungslose Grundeinkommen nur geboren werden kann in einer Gesellschaft, die unglaublich produktiv ist. Die Idee ist ja, dass das bedingungslose Grundeinkommen auch alle anderen Formen von Sozialleistungen ablöst. Es gäbe dann keine Arbeitslosenzahlungen mehr. Aber auf alle Fälle sind die Rechenmodelle so, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Vorteil hat, dass es auch unglaublich bürokratischen Aufwand erspart. Ich muss jetzt nicht mehr festlegen, wer kriegt den Anspruch, wer hat nicht den Anspruch. Das zweite ist, es erspart mir alle anderen Transferzahlungen wie Arbeitslosengeld und Zusatzleistungen. Und es befreit die Empfänger des bedingungslosen Grundeinkommens von dem Makel, Empfänger einer Transferzahlungen zu sein: Wenn es jeder hat, dann gibt es diese Differenzierung nicht.
Der Nachteil ist natürlich, dass man sagt: Ist das trotzdem finanzierbar? Überhaupt, wenn die Wirtschaftslage angespannt ist. Die Inflation würde auch sofort bedingungsloses Grundeinkommen mit auffressen. Das andere ist natürlich: Wie gerecht ist es, wenn das tatsächlich jedem zu kommt. Denn die Idee lautet, wenn es wirklich bedingungslos ist, dann muss es wirklich bedingungslos allen zukommen. Wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich ja sofort die Debatte: Auf welcher Lebenssituation kommt das jemandem zu? Und das ist dann echt nicht einfach zu diskutieren.
Es war die Marx‘sche Idee, dass die Arbeit die einzige Quelle des Reichtums ist und deshalb auch nur die Produkte dieses Reichtums auch noch an jene verteilt werden können, die auch durch ihre Arbeit dazu beigetragen haben.
Ich wollte nur vorhin sagen, weil Sie das bedingungslose Grundeinkommen als linkes Projekt skizziert haben. Es ist im Ursprung kein linkes Projekt. Es ist durchaus auch ein liberales Projekt. Die Idee war ursprünglich, mehr Menschen, die aufgrund ihrer Situation zu wenig Geld haben, um zu konsumieren, damit die Möglichkeit zu geben, am Wirtschaftskreislauf teilzunehmen und eben die Märkte zu stabilisieren. Während umgekehrt die Idee, dass die Arbeit die einzige Quelle von Einkommen und damit die einzige legitime Form der Teilhabe am sozialen Leben ist, diese Idee zumindest so links war wie auch bürgerlich. Es waren die Kommunisten und Sozialdemokraten, die seit dem 19. Jahrhundert verkündet haben, dieses alte Bibelzitat gebraucht haben, „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“. Es war die Marx‘sche Idee, dass die Arbeit die einzige Quelle des Reichtums ist und deshalb auch nur die Produkte dieses Reichtums auch noch an jene verteilt werden können, die auch durch ihre Arbeit dazu beigetragen haben. Das heißt also, diese hohe Bewertung von Arbeit auch als Quelle von Sinn, das ist dann tatsächlich auch eine sozialistische Idee gewesen – und das muss man der Gerechtigkeit halber sagen.
Glauben Sie, der österreichische Staat verfolgt heute noch den richtigen Ansatz, wie man Menschen in Bezug auf Arbeit erziehen möchte?
Ich denke, das hängt natürlich genau von der Frage ab, welchen Stellenwert man der Arbeit beimisst. Also die Idee des Sozialstaates war ja ursprünglich tatsächlich nur die zu alimentieren, die aus welchen Gründen auch immer selbstständig nicht ihre Einkommen erwerben können. Und es war immer so, dass man sagte, das Selbstbewusstsein eines Menschen hängt davon ab, ob er sich selbstständig durch seine Arbeit ernähren kann. Das heißt, es ist jetzt keine konservative Idee, sondern eine emanzipatorische Idee gewesen, die die Befreiung des Menschen erfordert, dass er durch seine Arbeit tatsächlich auch leben kann.
Ich darf noch darauf hinweisen, dass dieses Zusammendenken von Leistung und Arbeit ursprünglich eine links revolutionäre Idee war, die sich gegen die Feudalaristokratie gerichtet hat. Das Privileg der Aristokratie war immer stolz darauf zu sein, nicht arbeiten zu müssen und trotzdem alles zu haben. Da ist auch der Gedanke naheliegend zu sagen: Also das geht nicht, dass jemand davon lebt, dass andere für ihn arbeiten. Jeder soll von dem leben, was er selbst sich erarbeitet. Hier haben sich radikal bürgerliche und radikal linke Kräfte durchaus durchaus getroffen. Und die linke Kritik sozusagen am Kapitalismus war immer auch dadurch gekennzeichnet, dass die letztlich nicht selbst arbeiten, sondern die Früchte der Arbeit anderer genießen. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen nachdenken, tatsächlich unsere Einstellung zur Arbeit radikal ändern.
Wir werden nie in einer Welt leben, in der materielle Güter keine Rolle spielen. (…) Deswegen denke ich, dass dieses große Besorgnis, die manche – in dem Sinne dann tatsächlich bürgerliche Kräfte oder politische Personen – haben, dass, wenn ich den Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen gebe, dass alle in die Faulheit verfallen – dieses Besorgnis teile ich überhaupt nicht.
Wir müssten wirklich wegkommen von dieser Vorstellung, dass die Freiheit und die Selbstbestimmungsfähigkeit eines Menschen in seiner Arbeitsfähigkeit und in seiner Leistungsfähigkeit gründet. Sondern wir müssten jetzt dazu kommen, dass diese Freiheit und diese Selbstbestimmungsfähigkeit auch durch das reine Menschsein gewährleistet wird. Aber das geht eben doch nur dadurch, wenn die Gesellschaft als solche so viel produziert auf freiwilliger Basis, dass eben dann das bedingungslose Einkommen für alle gesichert sein kann. Und ich denke, rein theoretisch wäre das durchaus möglich. Einfach deshalb, weil ich davon ausgehe, dass auch Menschen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen, deshalb nicht aufhören werden zu arbeiten. Wir wollen zwar im hohen Maße auch emotionale und immaterielle Anerkennung – aber wir wollen auch so lange materielle Anerkennung, solange der Einzelne materielle Bedürfnisse hat. Wir werden nie in einer Welt leben, in der materielle Güter keine Rolle spielen.
Solange wir in so einer Welt leben, in der materielle Güter eine Rolle spielen, wird es auch monetäre oder entsprechende äquivalente Formen der Anerkennung geben. Deswegen denke ich, dass dieses große Besorgnis, die manche – in dem Sinne dann tatsächlich bürgerliche Kräfte oder politische Personen – haben, dass, wenn ich den Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen gebe, dass alle in die Faulheit verfallen – dieses Besorgnis teile ich überhaupt nicht. Kein erfolgreicher Unternehmer, also jeder Manager in einem großen Unternehmen, hat nach fünf Jahren so viel verdient, dass er sein Lebtag nicht mehr arbeiten müsste. Keiner hört auf zu arbeiten. Das ist für mich das beste Beispiel. Und warum sollen andere Menschen anders ticken als diese Manager?
In welche Richtung soll die Idee von Arbeit in einem Land wie Österreich gehen?
Ich denke schon, dass Arbeit als eine Quelle der Selbstbestimmungsmöglichkeit und der Freiheit des Menschen weiter eine ganz zentrale Rolle spielen soll. Aber ich denke auch, dass es notwendig ist, andere Formen von Aktivität, von Handeln, von sozialer Praxis, von kommunikativer Praxis zu pflegen, ohne sie unter dieses Paradigma der Arbeit zu stellen.
Wir sind ein Land, wo es unglaublich viele Freiwilligentätigkeit gibt. Ich sage bewusst nicht Freiwilligenarbeit sondern Freiwilligentätigkeit. Und sehr viele Bereiche unseres Lebens funktionieren eben nur deshalb, weil Menschen freiwillig bereit sind, Dinge zu tun, für die sie nicht bezahlt werden.
Sehr vieles wird digitalisiert werden in Zukunft. Ich habe ja nie gedacht, dass Menschen einmal im Sinne von Arbeit Geld damit verdienen können, dass sie sich dabei filmen lassen, wie sie Bananen oder sonst was essen. Wenn wir etwa an das Berufsbild des Influencers denken, der nichts anderes macht, als seinen persönlichen Lebensstil zur Quelle eines Einkommens zu machen. Es ist faszinierend, aber viele Influencer sagen, dass sie echt harte Arbeit betreiben.
Punkt ist, es gehört überhaupt nicht zu dem traditionellen Bild von dem, was wir bislang unter Arbeit verstanden haben. Und ich denke, diese Entwicklung, dass wir immer mehr darauf achten, dass unser Leben aus verschiedenen Bereichen besteht und eben nicht nur aus Arbeit – das halte ich für ganz zentral. Ohne nun deshalb den Genuss, der in einer erfolgreichen Arbeit und der damit verbundenen Anerkennung liegt, in irgendeiner Art gering zu schätzen.