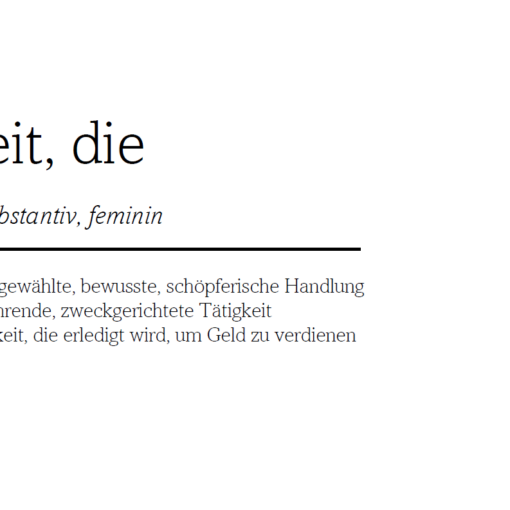Für viele Arbeitnehmer:innen in der Gastronomie gehören Drogen und Alkohol selbstverständlich zu ihrem Arbeitsalltag dazu, um dem Stress und Druck standzuhalten. Wie steht es um die Arbeitsbedingungen in der der Gastronomie in Österreich und wie hängt das mit dem Konsum zusammen?
Die Namen in diesem Artikel wurden von der Redaktion geändert.
Ein Artikel von Oskar Kveton und Annelie Eckert

“Es ist wahrscheinlich so, dass du dann durchfeierst und zwischen den Schichten zwei Stunden
schläfst, wenn an Schlaf überhaupt zu denken ist.” So beschreibt Michi, ein 35-jähriger Kellner, sein normales Wochenende auf der Arbeit.
Fröhliches Gelächter, leise Musik im Hintergrund, viel Essen und noch mehr Alkohol. Zwischendrin schlängelt sich Michi durch die Tische. Teller abräumen, Wasser nachschenken oder eine Weinempfehlung geben. Dazwischen ist gerade einmal Zeit einen Schluck Wasser zu trinken, mit der Kollegin hinter der Bar auf einen Shot Fernet Branca anzustoßen oder bei der Toilettenpause kurz noch eine Line Koks zu ziehen, um trotz der späten Uhrzeit weiter alle Wünsche der Kund:innen zu erfüllen.
Für viele ist ein schönes Abendessen und ein Drink nach der Arbeit ein perfekter Feierabend. Um diesen zu ermöglichen, arbeiten Menschen in der Gastronomie bis spät in die Nacht unter Stress und schlechten Arbeitsbedingungen. Ein schwieriges Umfeld, welches Süchte in unterschiedlichsten Formen begünstigt.
Statistiken vom Institut für Suchtprävention (ISP) zufolge sind fünf Prozent der österreichischen Bevölkerung alkoholkrank, zwölf Prozent betreiben riskanten Alkoholkonsum. Ab welcher Menge Alkoholkonsum riskant ist unterscheidet sich, laut Andrea Lins-Hoffelner vom Institut für Suchtprävention (ISP), zwischen Männern und Frauen: “Bei Frauen beginnt riskanter Konsum bereits bei 0,5 Liter Wein pro Tag; bei Männern bei einer Flasche Wein pro Tag.”
Der Arbeitsplatz kann laut Lins-Hoffelner unter anderem ein Faktor sein, der Sucht fördern kann. Dabei sind besonders Berufsgruppen gefährdet, die enormen Stress ausgesetzt ist: Arbeitnehmer:innen aus der Gastronomie und Eventbranche, Lehrer:innen, Journalist:innen und auch das Gesundheitspersonal. So arbeitet auch Michi in einem Arbeitsumfeld, das Süchte begünstigt. Aber ist es nur der Stress auf der Arbeit, der Arbeitnehmer:innen in der Gastronomie in die Sucht treibt?
Zahlen der Rechtsberatung der AK Wien zeigen, dass die Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe ebenfalls problematisch sind. Im vergangenen Jahr betrafen 10 Prozent aller persönlichen Beratungen diese Branche und das obwohl von allen Wiener-AK-Mitgliedern lediglich 4,3 Prozent im Gastgewerbe tätig sind. Im ersten Halbjahr 2022 gab es bereits 1280 persönliche Beratungen zum Thema Gastgewerbe in der Arbeiterkammer Wien. Dabei geht es oft um unbezahlte Überstunden, lange Schichten ohne Pausen und Arbeitszeiten bis spät in die Nacht.
Allerdings: Konkrete Zahlen, wie viele Arbeitnehmer:innen in der Gastronomie von riskantem Alkoholkonsum betroffen sind, gibt es hierzulande nicht. Zahlen aus der Schweiz belegen jedoch, dass 5,1 Prozent im Gastgewerbe einen problematischen Alkoholkonsum aufweisen. In Österreich dürfte das laut Lins-Hoffelner, ähnlich sein. Interviews mit 46 Menschen, die in der Gastronomie tätig sind, ergaben, dass über 50 Prozent der Befragten mehr als einmal pro Woche Alkohol in der Arbeit konsumieren. Fünf Prozent konsumieren Alkohol dabei öfter als drei mal die Woche. Wöchentlich konsumieren etwa 30 Prozent andere Drogen. Konfrontiert mit Drogen und Alkohol am Arbeitsplatz waren 87 Prozent.
Was macht das mit ihnen?

Arbeitsrausch
Servicekräfte arbeiten in nächster Nähe zum Gast. Dabei sollen sie stets freundlich, immer zur Verfügung und auch noch fachkundig sein. Nicht immer ganz einfach, wenn es zur Stoßzeit “knallt” und plötzlich ein Dutzend Tische pro Kellner:in gleichzeitig bedient werden wollen. Wenn in diesen Momenten nicht jeder Handgriff sitzt, kommt man sofort ins sogenannte “schwimmen” und rennt nur noch den erhobenen Händen und Zurufen der Gäst:innen nach – ohne System und Überblick. Das ist Alltag für Michi, einen 35-jährigen Kellner und Barkeeper. Die Ausbildung zum Restaurantfachmann hat er in einem bekannten Münchner Hotel absolviert und hat seither bei vielen unterschiedlichen Gastronomiebetrieben gearbeitet.
Seiner Meinung nach sind das hohe Arbeitspensum und der anhaltende Stress ausschlaggebend für Süchte in der Gastronomie. Insbesondere „Alkoholkonsum“ gehört in dem Business einfach dazu. „Es ist ein Grundstandard.” Allein durch die ständige Verfügbarkeit sei er ein stetiger Begleiter – spätestens nach der Schicht. In der Umfrage beschreibt es ein/e Teilnehmer:in wie folgt: “Es wird normalisiert, dass Mitarbeiter:innen selbst auch trinken – oder mal den Schnaps zwischendurch als `Teammeeting`. Man sitzt an der Quelle und darf als Mitarbeiter:in kostenlos konsumieren.”
Früher war es für Michi Normalität schon in der Früh vor der Schicht das erste alkoholische Getränk zu konsumieren. Doch dabei blieb es nicht. Für Michi gab es den ersten Kontakt zu Kokain im Urlaub mit Freunden. Dabei sollte es einfach mal ausprobiert werden und eine Nacht besonders lange und intensiv genossen werden. Bei dieser einen Nacht im Urlaub blieb es nicht. “Bei der Arbeit hat es sich dann eingeschlichen. Ich habe es hier und da mal probiert und dann immer öfter. In der Gastronomie kommst du einfach immer an solche Dinge.”
Nach langjährigem und übermäßigem Konsum von Alkohol und Kokain hat Michi inzwischen eine Veränderung durchlebt. Er arbeitet in einem Kaffee mit geregeltem Arbeitsalltag. Statt regelmäßiger Nachtschichten bis 6 Uhr früh endet sein Arbeitstag mittlerweile um spätestens 16 Uhr. Nach einem wilden Abend, im Zuge einer der seltenen Veranstaltungen, hat er seine Konsumgewohnheiten geändert. Kokain hat er seitdem nicht mehr angerührt. Auch dem Alkohol hat Michi erstmal ein halbes Jahr abgeschworen und trinkt nur noch hin und wieder zwei, drei Bier. Rückblickend auf die letzten Jahre Rausch, fasst er zusammen: “Bei mir hat der Job dafür gesorgt, dass es die Ausmaße angenommen hat, die es am Schluss hatte. Ohne den Job wäre es insbesondere beim Koks einfach beim Urlaub geblieben und es hätte sich nicht in den Alltag eingeschlichen.”
“Da viele Kolleg:innen konsumieren, ist der Zugang einfach und die Hemmschwelle niedrig”, so Michi Es sei ihm leichter gefallen zu arbeiten, insbesondere bei langen und sehr späten Schichten. Diese seien seiner Auffassung nach die Grundlage für Konsum im Service: “Alles was Richtung Spätschicht oder Nachtschicht geht, ist dann irgendwann allein schon wegen dem Arbeitspensum und der Länge der Schichten bei vielen, oder zumindest bei mir, unter anderem mit Kokain verbunden gewesen.”
Doch der Konsum hört nicht mit der Arbeit auf. Auch ein/e Teilnehmer:in der Umfrage bestätigt das: “Nach den stressigen Stoßzeiten, beziehungsweise nach der Schicht haben viele das Bedürfnis, herunterzukommen.“ Körperlich ist man bereits am Ende, aber der Stress scheint weiter im System zu bleiben. In der Gastronomie ist meist Alkohol vorhanden, daher liegt es nahe, nach der Schicht noch ein paar Bier zu trinken. Bei manchen ist dann aus “nach” “vor” und/oder “während” geworden.
Michi hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Selbst ohne Konsum von Alkohol oder Kokain hätten die meisten seiner Kolleg:innen nach der Arbeit nicht direkt schlafen können. Daher ging es in der Regel nach der Schicht noch weiter. “Gerade wenn du dann noch was getrunken oder konsumiert hast, geht es danach sicherlich noch bis in die frühen Morgenstunden oder sogar noch länger. Es ist wahrscheinlich so, dass du dann durchfeierst und zwischen den Schichten zwei Stunden schläfst, wenn an Schlaf überhaupt zu denken ist.”
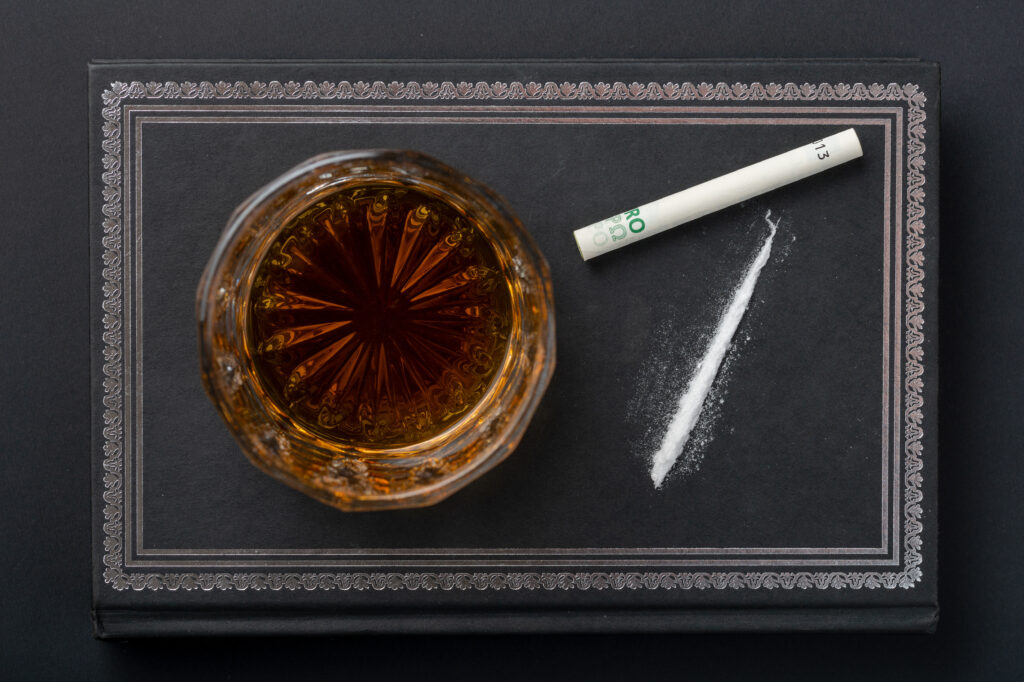
Koks in der Küche
Dass Drogen in der Gastronomie gang und gäbe sind, hat auch Clemens Baumgartner häufig erlebt: „Es war teilweise ganz normal, dass meine Kolleg:innen, wenn sie in der Arbeit angekommen sind, erst mal ´ne Nase gezogen haben. Ganz normal im Mitarbeiterraum. Als wäre es nichts.“ Clemens ist 23 Jahre alt, trägt einen Man-Bun, eine Brille und arbeitet als Koch in der Patisserie in einem Wiener Sterne-Hotel. Es ist 20 Uhr. Seit sechs Stunden ist Clemens in der Küche und wird auch noch bis Mitternacht hier sein. Wenn es gut läuft. Meist läuft es aber eher so, dass Clemens länger bleibt. Dass er heute arbeiten muss, hat er erst vor zwei Tagen erfahren. Der Dienstplan kommt am Samstag, wenn er Glück hat, schon am Freitag. Immerhin. Bei seinem früheren Arbeitgeber hat der junge Koch am Sonntagabend erfahren, wann er am Montag in der Küche antreten muss.
Spontane Dienstpläne führen dazu, dass Clemens, seitdem er 13 Jahre alt ist, das Gefühl, etwas zu verpassen, nur allzu gut kennt. Man bezeichnet es auch als FOMO – the fear of missing out. „Wenn man viel in der Küche steht und auch am Abend, dann verpasst man eben sehr viel: Die Freunde treffen sich, es sind Fußballspiele und man ist nicht dabei. Man geht nicht ins Kino, nicht auf Konzerte.” Mittlerweile hat er sich daran gewöhnt.
Aktuell arbeitet Clemens Baumgartner 40 Stunden die Woche, meist von 14:30 Uhr bis Mitternacht. So steht es zumindest auf dem Papier. Aufgrund des Personalmangels ist eher eine 45- bis 50-Stunden-Woche die Regel. Knapp ein Viertel aller Arbeitnehmer:innen im Gastgewerbe müssen, wie Clemens, regelmäßig nach 22 Uhr arbeiten. Immerhin bekommt der 23-jährige seine Überstunden aktuell bezahlt. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, weiß er aus früheren Jobs. „Überstunden wurden nicht aufgeschrieben und somit auch nicht bezahlt.“ Diese Erfahrung deckt sich mit den Ergebnissen einer aktuellen Erhebung der Arbeiterkammer zu den Arbeitsbedingungen in der Gastronomie: Demnach bekommen in der Branche, Stand Frühjahr 2022, mehr als ein Drittel der Arbeitskräfte für ihre Mehrarbeit kein Geld.
Dass Überstunden, Stress, unregelmäßige Arbeitszeiten und wenig Erholung zwischendurch in der Gastronomie Usus sind, weiß Clemens mittlerweile und hat gelernt, damit umzugehen. Viele seiner Kolleg:innen aber können dem Druck nicht standhalten – zumindest nicht ohne den Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen. Kokain sei dabei das gängigste, erzählt Clemens. Das hänge in erster Linie mit dem Faktor Zeit zusammen: „Wenn du was ziehst, ist es halt schnell erledigt.“ Und das ist praktisch, denn eigentlich pressiert es in der Küche immer.
Die Stoßzeit beginnt. Geschirr klirrt und im Hintergrund läuft Radio Wien. „Je besser die mise en place, desto unwahrscheinlicher der Stress“, erklärt der Koch. „Mise en place“ ist der Fachbegriff für die Vorbereitung, damit später, wenn es ernst wird, so wenig Handgriffe wie möglich nötig sind. Denn während der Stoßzeit stehen alle in der Küche enorm unter Druck. Der Umgangston wird rauer und lauter: „Manchmal wird man angeschrien, weil man zu langsam ist, manchmal, um Ansagen Nachdruck zu verleihen oder um klarzumachen, dass etwas wichtig ist. Manchmal wird aber auch nur geschrien, um die ganzen Geräusche in der Küche zu übertönen.“ Das sei meist nicht böse gemeint, sagt Clemens. „Manchmal kracht´s schon richtig, aber meistens ist es danach dann auch wieder gut.“
Das erste Mal mitbekommen hat Clemens den Drogenkonsum in seinem Arbeitsumfeld während eines Praktikums, als er 15 Jahre alt war: „Da war ich auf der Toilette und hab dann gehört wie neben mir was gezogen wurde. Das war für mich so ein bisschen: Wow, jetzt war ich mal dabei und hab es gehört, aber gewundert hat es mich damals schon nicht.” Praktika in den Sommerferien, während seine Freund:innen auf Urlaub waren, gehören zur Kochschule, die Clemens ab dem Alter von 13 Jahren besuchte, dazu. Eine Ganztagsschule, 45 Stunden pro Woche, mit praktischen Fächern wie Kochen oder Serviceunterricht und regulären Fächern wie Deutsch und Rechnungswesen. Dem Druck in seinem ersten Praktikum vor zehn Jahren standzuhalten, war für ihn nicht einfach: „Ich habe öfter geweint, wegen des ganzen Drucks. Teilweise in der Arbeit, teilweise zu Hause“, erinnert er sich. Der permanente Stress machte sich auch physisch bemerkbar: Nach nur wenigen Wochen bekam der damals erst 13-jährige eine Gastritis. Dieser Druck ist aber genau auch bis heute der „Rausch“, den Clemens an seinem Beruf schätzt: „Das Gefühl, wenn nach der Stoßzeit dann auf einmal dieser Druck abfällt, das mag ich.“
Viele Kolleg:innen können diesen “Rausch” nur berauscht von anderen Substanzen ertragen. Angeboten wurde es Clemens oft, abgelehnt hat er immer. Außer einem kleinen Belohnungsbier nach der Rush Hour konsumiert er im Job keine Substanzen. Während der Arbeit will der junge Koch klar im Kopf sein. Das bedeutet aber nicht, dass er grundsätzlich nichts konsumieren würde. Clemens erklärt, man müsse unterscheiden zwischen denen, die in der Arbeit etwas nehmen, um leistungsfähiger zu werden und denen, die das nach der Arbeit zu Hause tun, um aus dem Alltag auszubrechen. Zu Letzteren würde er sich zählen. „Wenn ich um ein Uhr nachts von der Arbeit nach Hause komme, will ich nicht direkt schlafen gehen, das ist mir zu fad.“ Sich einen „ansaufen“ würde zu lange dauern und Konsequenzen für die Arbeit am nächsten Tag haben. Also konsumiert Clemens nach der Arbeit gerne Cannabis: „Dann hau ich mich noch vor den Fernseher, mach mir was zu Essen und rauch einen Joint dabei.“ Andrea Lins-Hoffelner von der ISP erklärt, dass für einige der Konsum nach der Arbeit ein Mittel ist, um den Stress zu „vergessen“: „Wenn man nicht abschalten kann, greift man gerne zu einer Substanz. Das heißt zu Alkohol oder Cannabis zur Beruhigung.“
Unsere Kollegin Laura Lorber hat sich die Arbeitsbedingungen eines DJ’s angeschaut. Diesen Artikel finden Sie hier:
Wenn Feiern zum Beruf wird